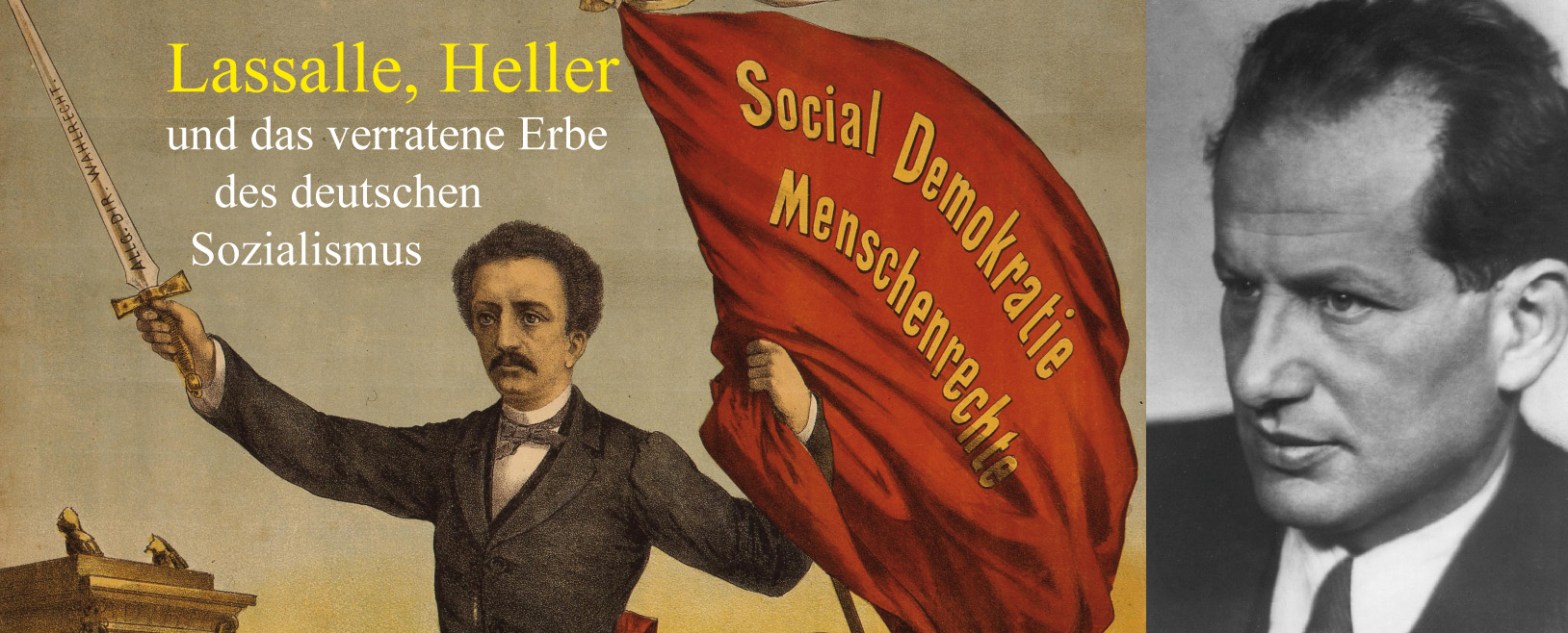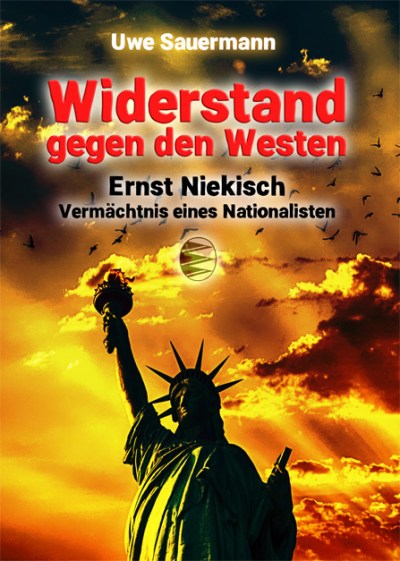von Dr. Christian Böttger
Was Volks- und Völkerkunde zur Klimadiskussion beitragen können
Im Mai 2019 fand unter dem Titel: „Annalena Baerbock vor Ort“ eine Open-Air-Veranstaltung statt. Dort führte die Grünen-Politikerin, in freier Rede und etwas holprig, Folgendes aus:
„Ich hab´ letztens gelesen, bei der BBC ist das so, die sagen, unsere öffentlichen Kanäle sind aufgrund von Fakten und Wissenschaft. Und z. B. Klimaleugner werden da in TV-Sendungen überhaupt nicht eingeladen, weil sie sagen: wir argumentieren hier auf der Grundlage von Fakten und wir geben denjenigen, die diese Fakten leugnen, kein Forum. Und ich glaube, daß sollte auch der Standard dann in öffentlichen Medien hier bei uns sein.“ (1)
Diese Einstellung bekräftigte sie noch einmal beim Kongreß des Verbandes der deutschen Zeitschriftenverleger im November des gleichen Jahres. Es dürfte klar sein, daß eine solche Haltung weder im Einklang mit dem Grundgesetz steht, noch mit der vielbeschworenen „Offenen Gesellschaft“ – ein Begriff, den man stets als Offenheit gegenüber Migranten fehlinterpretiert und nicht als Offenheit gegenüber Argumenten und Meinungen versteht, wie er ursprünglich gemeint war. (2) Allerdings ist dieses Postulat von Karl Popper (1902 – 1994) ohnehin nur theoretischer Natur, da jeder Gesellschaft die Tendenz zur ideologischen Geschlossenheit innewohnt. Die aktuellen Entwicklungen in der BRD sind das beste Beispiel dafür. Das betrifft vor allem eben auch die These vom menschengemachten Klimawandel.
Die Annahme, daß der CO2-Ausstoß einen Klimawandel bewirken könnte, ist nicht neu. Schon als Abiturient bin ich mit dieser Frage konfrontiert worden und ich habe dieses Problem damals nicht anders verarbeitet, als die Jünger von Greta Thunberg das heute tun. Ich sehe mich deshalb weit entfernt davon, ein „Klimaleugner“ zu sein, auch wenn mein Wissen heute wesentlich über meine damaligen Erkenntnisse hinausgeht. In einer Jahresarbeit im Fach Biologie schrieb ich 1973 dazu folgendes:
„Eine bedeutende Nebenwirkung, die das in der Atmosphäre enthaltene Kohlendioxyd hervorruft, ist die Fähigkeit, den thermischen Zustand der Atmosphäre zu beeinflussen und somit unerwünschte Klimaveränderungen herbeizuführen. Kohlendioxyd besitzt die Fähigkeit, Sonnenstrahlen sehr intensiv zu absorbieren und wie das Glasdach eines Gewächshauses zu wirken. Es kann zwar von Sonnenlicht durchdrungen werden, ist aber nicht in der Lage, infrarote Wärmestrahlung nach außen gelangen zu lassen. Diese Tatsache wurde schon im vorigen Jahrhundert erkannt. Eine Verdopplung der Kohlendioxydmenge in der Atmosphäre würde eine Temperaturerhöhung um ca. 2 Grad C verursachen. Da aber schon eine Temperaturerhöhung von 4 – 5 Grad C die Eismassen der Erde zum Schmelzen bringen würde, könnte eine Erhöhung des Meereswasserspiegels die Folge sein.“ (3)
Im Gegensatz zu heutigen Darstellungen erwähnte ich damals aber noch gegenläufige Tendenzen durch den Ausstoß von industriellem Staub, das Abschirmvermögen des Staubes, der so eine Erdabkühlung begünstigen könnte. Und hinsichtlich des Schmelzens von Gletschern spielt der Staub auch eine Rolle, was die einseitige Sicht auf das CO2 relativiert:
„Die Auswirkungen des Staubes können verschiedener Art sein. So ist uns bekannt, daß durch Staubablagerungen auf Gletschergebirgen der Reflexionsgrad vermindert wird, wobei eine stärkere Absorption der Sonnenstrahlen erfolgt. Die Folge davon wäre ein vorzeitiges Schmelzen der Eismassen.“ (4)
Es steht z. B. auch außer Frage, daß die weltweit stattfindenden Urbanisierungstendenzen und die damit einhergehende Schaffung von städtischen Wärmeinseln die Temperatur der unteren Atmosphäre verändert hat – ganz unabhängig vom CO2-Ausstoß.
All diese Sachverhalte spielen heute in der Diskussion gar keine Rolle mehr. Warum, weiß ich nicht. Ich werte das als ein deutliches Zeichen dafür, daß es gar nicht mehr um wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern nur noch um ideologische Selbstbehauptung verschiedenster Interessengruppen geht. Auch andere Tatsachen, wie der natürliche Klimawandel durch die verschiedenen Klimazyklen oder kosmische Strahlung werden nicht mehr erwähnt oder zu einer Randerscheinung erklärt. Die aufgezeigten Zitate belegen jedenfalls, daß ich mich mit diesem Thema schon zu einer Zeit beschäftigt habe, als an Annalena noch gar nicht zu denken war. Die von mir 1973 dargelegten Auffassungen waren damals geradezu „revolutionär“. Heute müßte die Wissenschaft aber schon weiter vorangeschritten sein und könnte neue Zusammenhänge aufzeigen, sollte man meinen.
Während meines Geschichtsstudiums von 1983 bis 1988 erfuhr ich ganz vage, wie negative Klimaveränderungen zu Völkerwanderungen und Bevölkerungsrückgang geführt haben könnten – und habe mir noch nichts dabei gedacht. Erst als 2010 ein ehemaliger sorbischer Kommilitone von mir, Peter Milan Jahn, seine Dissertation vorgelegt hat, wurde ich mit dem Phänomen der sog. „Kleinen Eiszeit“ konfrontiert. (5) Die politisch ausgerichtete Klimaforschung kennt zwar auch Begriffe wie Römisches Optimum, Mittelalterliche Warmzeit und Kleinen Eiszeit, leugnet allerdings ihre reale Existenz. Wie dies geschieht, kann man auf klimafakten.de ganz gut nachvollziehen. Dort lesen wir:
„Erstens war die Mittelalterliche Warmzeit ein eher regionales Phänomen. Zwar gibt es in der Tat Belege dafür, dass damals Teile der Erde (etwa der Nordatlantik) wärmer waren als heute. Diese Erwärmung und der damit verbundene Rückgang des arktischen Eises ermöglichte es beispielsweise den Wikingern, weiter nach Norden zu fahren, als dies vorher denkbar gewesen wäre. Doch gleichzeitig war es an anderen Orten der Erde wesentlich kälter als heute, … Auch weitere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass es keine Belege gibt für eine weltweite ‚Mittelalterliche Warmzeit‘ – ebenso wenig übrigens wie für eine weltweite ‚Kleine Eiszeit‘, die nach manchen Behauptungen danach stattgefunden haben soll.“ (6)
Diese Darstellungen eint meistens die Vorstellung, die Kleine Eiszeit habe nur partiell und auf der Nordhalbkugel stattgefunden, während es anderswo wärmer war. Doch in den letzten Jahren sind immer mehr Klimaforscher zu dem Ergebnis gekommen, daß die Kalt- und Warmzeiten weltweite Phänomene waren. Bei den Studien für mein Südafrika-Buch (7) bin ich u. a. auf die Forschungsergebnisse des großartigen südafrikanischen Historikers Thomas Huffman (*1944) von der Archäologischen Abteilung der Universität Witwatersrand gestoßen. Mit seinem Handbuch zur südafrikanischen Eisenzeit (200 n. Chr. – 1840) hat er 2007 ein gigantisches Werk von unschätzbarem Wert vorgelegt, an dem heute kein Autor, der zur Geschichte Südafrikas schreibt, vorbeikommt. Anknüpfend an die Forschungsergebnisse (8) des namhaften südafrikanischen Klimaforschers Peter Tyson, (Universität Witwatersrand) gelang es Huffman, die Bedeutung des permanenten Klimawandels für die Prozesse der Migration und Ethnogenese in Südafrika herauszuarbeiten:
„Throughout the Iron Age, climatic fluctuations played a significant role in structuring human geography. When EIA people first entered southern Africa, the climate was warmer and wetter than today. Between about AD 700 to 900 the climate was colder and drier than at present, and EIA farmers would have retreated to more optimal areas. The climate became better again sometime during the Middle Iron Age, between AD 900 to 1300. At about AD 1700, however, the ‘Little Ice Age’ reached its nadir, and its impact upon human population was particularly severe.“ (9)
„Während der gesamten Eisenzeit spielten Klimaschwankungen eine wichtige Rolle bei der Strukturierung der menschlichen Geographie. Als die Leute der Frühen Eisenzeit zum ersten Mal in das südliche Afrika eindrangen, war das Klima wärmer und feuchter als heute. Zwischen etwa 700 und 900 n. Chr. war das Klima kälter und trockener als heute, und die Landwirte der Frühen Eisenzeit hätten sich in optimalere Gebiete zurückgezogen. Das Klima wurde irgendwann in der mittleren Eisenzeit zwischen 900 und 1300 n. Chr. wieder besser. Um 1700 n. Chr. erreichte die ‚Kleine Eiszeit‘ jedoch ihren Tiefpunkt, und ihre Auswirkungen auf die menschliche Bevölkerung waren besonders gravierend.“ (Übers. C. B.)
Zu diesen gravierenden Auswirkungen gehörte, daß ganze Landstriche (das sog. Highveld) in dieser Zeit von den Bantustämmen weitgehend verlassen wurden und die Buren hier später nachrücken konnten, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, wenn man von der Zufallsbegegnung mit den Matabelestämmen 1837 einmal absieht. Allein der hier dargestellte Sachverhalt zeigt aber unmißverständlich, daß die Annahme, die Kleine Eiszeit habe nur partiell und auf der Nordhalbkugel stattgefunden, nicht stimmen kann. Nach der Darstellung von Huffman/Tyson finden die Klimazyklen der Nordhalbkugel auch in Südafrika ihre Entsprechung. Klimafakten.de scheint mir deshalb keine seriöse Quelle zu sein, auch wenn MDR-Aktuell (Hörfunk) sich auf diese beruft. (10) Eine Institution, die auf alle Fragen eine Antwort weiß und keine Zweifel und Widersprüche mehr kennt, nennt man im allgemeinen Sekte. Der MDR täte gut daran, sich von den „Fake News“ von klimafakten.de, hinter denen eine ominöse private Stiftung steht, zu distanzieren.
Für die nördliche Hemisphäre hat Dr. habil. Harald Kehl, PD an der TU-Berlin, Institut f. Ökologie, 2008 folgende Graphik erarbeitet (11), die Auskunft über das zyklische Auftreten von Optima und Pessima in den letzten 11.000 Jahren gibt:

Aber was bedeuten diese auf- und niedergehenden Kurven ganz praktisch, also mikrohistorisch für das Alltagseben der Völker und Kulturen? Greifen wir die letzten drei Optima heraus, weil sie mit drei kulturellen Entwicklungsschüben in Europa einhergehen. Das erste Optimum, was uns interessieren soll, fällt mit der Blüte der Spätbronzezeit zusammen, die die Lausitzer Kultur, die nordische Bronzezeitkultur und die Urnenfelderkulturen hervorbrachte. Charakteristisch für die Urnenfelderkulturen sind zahlreiche neue Bronzeprodukte. Das beginnt bei einfachen Arbeitsgeräten, geht über filigranen und anspruchsvollen Schmuck bis zu hochwertigen Waffen. Es entstanden gußtechnisch kompliziertere Bronzen. Bronzeschild, Kappenhelm, Lanze und Griffzungenschwert setzten sich jetzt in der Bewaffnung durch. Die Verwendung des von Pferden gezogenen Streitwagens ist durch Fürstengräber bezeugt. Der Pflugbau und die Einführung weiterer Getreidearten wie Roggen und Hafer gehören zu den Verbesserungen der landwirtschaftlichen Produktion. Große, mit Wällen und Gräben befestigte Anlagen – oft auf Höhen – zeugen vom Zusammenschluß der Menschen in größeren Verbänden. (12) Ein Bevölkerungswachstum ist unter diesen Bedingungen naheliegend, so daß es in diesem Zeitabschnitt zu ausgedehnten Wanderzügen kam (z. B. die Wanderungen der Dorer nach Griechenland oder der Italiker nach Italien.). Auch die Prägermanen der nordischen Bronzekultur (Nordischer Kreis), die in engem Zusammenhang mit den anderen Indoeuropäern der Urnenfelderkulturen gesehen werden müssen, waren von dieser kulturellen Blüte betroffen. Das bezeugen zahlreiche Mecklenburger Bodenfunde (Königsgrab von Seddin, Schwerter aus Barkow, bronzene Spiralplattenfibeln aus Plauerhagen usw.). Doch in der späten Bronzezeit, etwa seit dem 9. Jh. v. Chr., setzten gravierende Veränderungen in der Kulturentwicklung ein. Ein stärkerer Rückgriff auf primitive Rohstoffe wie Knochen und Stein ist jetzt im nördlichen Mitteleuropa zu beobachten. (13) Das hat zur Legende von den „primitiven Germanen“ beigetragen. Solche von Lehrern der 1968-Generation in Westdeutschland verbreiteten Legenden sind mir persönlich von Zeitzeugen berichtet worden und noch heute virulent – in Unkenntnis der wahren Zusammenhänge. Wodurch aber war dieser Zeitabschnitt der Bronzezeit und beginnenden Eisenzeit gekennzeichnet? Die obenstehende Graphik gibt uns eine eindeutige Auskunft. Es handelte sich um den Beginn einer schrecklichen Kaltzeit am Ende dieser Periode.
Erst als es um 200 v. Chr. wieder bedeutend wärmer zu werden begann, kam es über vier Jahrhunderte zu einer neuen Blüte der Kulturentwicklung. Die Klimaforschung spricht vom „Römischen Optimum“, auf dessen vielbeachtete Kulturentwicklung ich nicht weiter eingehen muß. Jedenfalls bricht diese Temperaturentwicklung etwa um 200 n. Chr. ab und das Klima wird in der Völkerwanderungszeit etwas rauer und kühler (siehe Graphik). Es kommt zu einem allgemeinen Niedergang der antiken Stadtkultur und Baukunst. Das 6. und 7. Jh. n. Chr. bildeten in kultureller Hinsicht die „dunklen Jahrhunderte“ und erst ab 800 spricht man in der Kulturgeschichte von der „Karolingischen Renaissance“, die den dunklen Jahrhunderten der Völkerwanderungszeit und des Frühmittelalters ein Ende setzte. Der Kulturaufschwung zur Zeit Karls des Großen betraf das Bildungswesen, die Literatur und die Baukunst. Zwischen 900 und 1300 erreichte die „Mittelalterliche Warmzeit“ ihr Optimum. Jetzt wurde es bedeutend wärmer und viele Gletscher schmolzen. Im Berliner Raum wie auch in anderen Gegenden der norddeutschen Tiefebene konnten im Hochmittelalter sogar erfolgreich Wein angebaut werden. Doch vom 15. und vor allem vom 16. Jh. an begann es allmählich kälter zu werden. Gemälde vom 16. und 17. Jh. zeigen zugefrorene Kanäle in den Niederlanden. Das war der Beginn der „Kleinen Eiszeit“.
Der Frage, wie sich u. a. die Kleine Eiszeit mikrohistorisch auf die Kultur und Lebensweise der unteren Volksschichten ausgewirkt hat, ist der sorbisch-wendische Volkskundler Peter Milan Jahn in dem bereits erwähnen gigantischen Werk nachgegangen. Es liefert uns konkrete Einblicke in die an der Neiße gelegene Oberlausitzer Standesherrschaft Muskau an der Wende vom 18. zum 19. Jh. Bekanntheit erlangte die Landstadt durch den Fürsten Hermann von Pückler-Muskau, der mit seinem Landschaftspark als Landschaftskünstler in die Geschichte eingegangen ist. Bad Muskau zählt heute zum amtlichen sorbischen Siedlungsgebiet. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Leben von Hanso Nepila (1766 – 1856), ein wendischer Fronarbeiter aus Rohne. Zu den ausgewerteten Quellen und Dokumenten gehören neben der Autobiographie Nepilas auch alte Chroniken des „Lausitzischen Magazins“, das 1768 sein Erscheinen als wissenschaftliche Zeitschrift begonnen hatte. Ein Meteoriteneinschlag am 16. Februar 1768 bei Lauban in der östlichen Oberlausitz bildete für diese die Veranlassung, ein täglich geführtes Wetterjournal für die Oberlausitz zu publizieren.
Die Wetteraufzeichnungen des Magazins zeigen ein detailliertes Bild. Zunächst fallen ungewöhnliche Kälteeinbrüche im Frühjahr auf, so für 1768, als starke Nachtfröste zu den Eisheiligen die Baumblüte schädigte. Ein ohnehin verregneter Sommer wurde von schweren Gewittern im Herbst abgelöst und im November kam heftiger Frost hinzu, der die Erde ¼ Elle tief frieren ließ. (14)
Obwohl sich der Februar im darauffolgenden Jahr (1769) durchaus vorfrühlingshaft zeigen konnte, war die zweite Märzhälfte eher durch heftige Nachtfröste und Schneegestöber gekennzeichnet. Im Mai regnete es bei empfindlicher Kälte bis zum 12. ununterbrochen, was zu dramatischem Mehltaubefall führte. Eine Gewitterserie beherrschte den Juni. Der von langanhaltenden Niederschlägen geprägten Sommer wurden von heftigen Frösten im Herbst abgelöst. Schnee oft schon Anfang Oktober verhinderte die Aussaat des Roggens. Gewaltig tobende Wirbelstürme im November schlossen sich daran an und ab 16. November lag bereits zu viel Schnee, um die Felder weiter bestellen zu können.
Auch im darauffolgenden frostigen Frühjahr schneite es vom kalendarischen Frühlingsanfang bis Ende März fast ununterbrochen, obwohl es seit Weihnachten überwiegend nur matschig und regnerisch war. Anfang April taute es, von starken Überschwemmungen begleitet, doch schon über Ostern sollte sich das ändern. In der Nacht zu Karfreitag, dem 13. April 1770, erwachte man mit heftigen Schneefällen, die nur von etwas Sonne am Ostersonntag unterbrochen wurden. Danach wurde es trübe und kalt und am 31. Mai so frostig, daß das ganze Gemüse nebst Kartoffeln eingingen. Pünktlich zum Beginn der Getreideernte stellte sich mit Hagel und Gewitter auch noch eine den ganzen Sommer anhaltende Regenzeit ein. Überall in Mitteleuropa stiegen die Getreidepreise. In der Schweiz (Basel) hatte sich schon 1770 der Kornpreis gegenüber 1768 fast verdoppelt. (15) Eine Besserung war nicht in Sicht, denn starke, lang andauernde Regenfälle im Oktober 1770 machten auf eine gute Ernte im darauffolgenden Jahr wenig Hoffnung.
Das Bild im Januar 1771 wurde von ungeheuren Schneegestöbern bestimmt. Starke Temperaturschwankungen folgten im Februar und Ende März setzte eine anhaltende Kältewelle mit starken Schneefällen ein. Die Schneedecke war zu Ostern übersät mit erfrorenen und verhungerten Singvögeln und Hasen. „Die Heidebauern, anstatt mit der Feldbestellung und Sommeraussaat zu beginnen, mußten sich einen Weg zu ihren Kirchen Schaufeln, wenn sie etwas über Ostern hören wollten.“ (16) Naßkalte Witterung um den Gefrierpunkt beherrschte den April. Im Juni regnete es mit einer Ausnahme jeden Tag. Regenschauer und starke Güsse wechselten sich ab. Der wärmste Sommertag war der 2. September und auch im Oktober gestaltete sich das Wetter zur Winteraussaat vielversprechend. Vier Monate lang hatte man nichts als Niederschläge erlebt. Die daraus resultierende Hungersnot erreichte deshalb auch vor der Ernte 1772 ihren Höhepunkt und erfaßte mehr oder weniger ganz Mitteleuropa. Die Produktionsausfälle in der Landwirtschaft bewirkten nicht nur schwere Hungersnöte, sondern auch Säuglinge und Kleinkinder erkrankten unter der extremen Witterung.
Zweimal hintereinander war die Ernte total vernichtet worden. Es kam zu kollektiven Auszügen bettelnder Bauern, aber auch von kleinen Handwerkern und Gewerbetreibenden bereits Ende des Jahres 1771. Auch aus dem Erzgebirge sind solche Scharen von Bettlern bezeugt. Der Weg verlief von der Oberlausitz aus nicht in Richtung Dresden, das von Bettlern aus dem Erzgebirge überlaufen war, sondern in nördliche Richtung. Zuerst ging es nach Cottbus, einer damals Brandenburgischen Exklave in Sachsen, in der ebenfalls wendische Bauern lebten. Aber dort war an eine gute Ernte auch nicht zu denken gewesen. Doch einen Unterschied gab es: „Die preußischen Domänenbauern im Kreis Cottbus wurden über die Kriegsmagazinverwaltung ihres Staates aber viel besser mit Getreide versorgt.“ (17) Seit Februar 1772 lief, von Küstrin aus, die Versorgung für den Kreis Cottbus an. Manches Grenzdorf im Kreis Cottbus mußte durch Wachen regelrecht abgeriegelt werden, um die Hilfesuchenden abzuwehren. Die einzelnen Staaten im Reich ergriffen nun protektionistische Maßnahmen. Bereits im September 1771 war in Sachsen ein Verbot für die Getreideausfuhr ergangen. Etwas später wurde die Einfuhr von Lebensmitteln von Zöllen befreit. In halb Europa begann man die Grenzen dicht zu machen, um eine negative Handelsbilanz zu vermeiden und den jeweiligen Binnenmarkt am Leben zu erhalten. Der Argwohn gegenüber kontinental operierenden Großhändlern wuchs. Ende Februar 1772 sah sich der Rat der Stadt Leipzig gezwungen, eine Anordnung zur Ausweisung von Bettlern zu erlassen. Bis Ostern 1772 waren in den Straßen von Leipzig 3.732 Todesopfer der Hungersnot zu beklagen. In Dresden waren es bis Ostern 6.225 Personen. Das Getreide, das über den Hamburger Hafen nun eintraf, kostete das Dreifache des normalen Preises und war für die Armen unerschwinglich. (18)
Die zurückgebliebenen Familienangehörigen in den Heidedörfern der Lausitz waren am Ende, denn Anfang März 1772 war selbst das Tierfutter von den Bewohnern aufgezehrt. Das Vieh hatten die Fronbauern in den standesherrlichen Forst getrieben, wo es sich selbst dürres Waldgras suchen muße. Das hatte aber zur Folge, daß nicht nur das Brot fehlte, sondern auch Milch, Butter und Käse. Man behalf sich mit dem „Grünen Mus“, das sich im Frühjahr 1772 alle bäuerlichen Einwohner hier teilten. Dieses war weder gesalzen noch gefettet und bestand aus allem frischen knospenden Grünzeug, Blättern von Linden- und Pflaumenbäumen, Hopfen, Hederich, Raps, Kartoffelkraut und Brennnesseln. Die Kinder pflückten Löwenzahn, Pfennigkraut, Sauerampfer und Schafgarbe und formten daraus eßbare Knöllchen. Um den Hunger zu stillen wurde auch eine Art von Brotersatz gebacken, der aus gemahlenen Eicheln, Spreu vom Heidekorn, vom Leinsamen, den Blüten vom Heidekraut und geschnittenem Stroh bestand. (19) Daß in solchen Notzeiten auch Hunde und Katzen als Nahrung dienten, ist verständlich.
Ein besonderes Phänomen jener Zeit kennen Ethnologen von allen Kontinenten. Es wird als „Geophagie“ bezeichnet und bedeutet die kollektive Sitte, bestimmte ton- und salzhaltige Erden zu verzehren. Instinktiv auf diese Weise angegangene Mangelerscheinungen von Salzen und Spurenelementen konnten so ausgeglichen werden. Bei den Heidewenden in der Kleinen Eiszeit ist diese kollektive Sitte nur von Kindern bezeugt: Im Rahmen von gespielten Familienfesten und großen Festmählern formten die Kindergruppen zunächst Kringel und Lebkuchen aus Lehm. Danach „verrührten die Kinder ihre Kreationen mit Wasser, dem sie mitunter frische, helle Holzspäne beimengten und erhielten dann eine Pampe, die sich mit einiger Phantasie wie weißer Mehlbrei mit Milch ansah und tatsächlich essen ließ.“ (20) Dabei erwies sich manches lehmhaltige Material als zu grob, scharf und steinig, so daß es zu Magenbeschwerden kam.
Trotz aller Anlaufschwierigkeiten, die den völlig entkräfteten Lausitzer Fronbauern im Sommer 1772 zu schaffen machten, konnte die Ernte in jenem Jahr vollständig geborgen werden. Auch 1773 war die Ernte gut geraten.
Die Mißernten und Hungersnöte waren zum Glück nicht immer zur gleichen Zeit in Europa aufgetreten. Sie häuften sich lediglich im 16., 17. und 18. Jh. In Frankreich sticht besonders das Jahr 1788 heraus:
„Aber die Vorsehung … verhängte im Jahr 1788 eine neue Heimsuchung über Frankreich, die den einzelnen schwerer traf, als der noch so scharfe Steuerdruck und als alle Sorge um den finanziellen Zustand des Staates. Nämlich eine allgemeine Mißernte mit nachfolgender Hungersnot, die das Tohuwabohu der Erregungen und Anklagen auf das leidenschaftlichste vermehrte. … Nicht auf das ernste, mühselige und fast verzweifelte Studium der möglichen Abhilfen waren die allgemeinen Schichten Frankreichs gestimmt, als 1789 die Generalstände in Versailles zusammenkamen. … Nicht auf Hilfsbereitschaft für die die Nation führende Monarchie war diese innerhalb der Etats généraux mitvertretende Erwartung Frankreichs gestimmt, sondern auf Anklage und Beschuldigung, die zum Haß wurden, sobald der Name Marie Antoinettes in Betracht kam, der ‚Autrichienne‘, der ‚Madam Déficit‘. Denn die Königin wurde in ihren Einflüssen auf den König und die Regierung – und in dem Unheil dieser Einflüsse – immerhin weit überschätzt.“ (21)
Der Rest ist bekannt. Am 16. Oktober 1793 bestieg Marie Antoinette, die „Österreicherin“, die eigentlich Maria Antonia hieß, die Guillotine. Der Fränkische Adel folgte ihr nach. Es kam zu einem tiefgreifenden Elitenwechsel. Und wieder fällt die Kaltzeit mit dem Abschluß einer Kultur zusammen. Das Abendland, das mit der Taufe König Chlodwigs 498 in Frankreich seinen Ausgangspunkt genommen hatte, unter Karl dem Großen eine erste Blüte erlebte, beendete in der kleinen Eiszeit seinen Zyklus. Das soll nicht heißen, daß die Kleine Eiszeit die Ursache für die Revolution war, aber sie lieferte den dazu notwendigen Impuls, den revolutionären Elan und eröffnete so die Möglichkeit zum Abschluß des Kulturzyklus, einer ganzen Epoche. Es folgte die „Moderne“, die nur noch ein Surrogat davon war.
Die Kleine Eiszeit endete jedoch nicht abrupt, denn diesbezügliche klimatische „Ausreißer“ gab es noch bis in das 19. Jh. hinein. So kam es im Deutschen Bund 1847 zu 193 bekannten Hungerunruhen. Solche Lebensmittelunruhen häuften sich zwischen 1840 und 1850. Die Kartoffel- und Getreideernte war z. B. in Preußen im Jahr 1846 um 30 – 50% geringer ausgefallen, als in den Vorjahren. In Schlesien ging der Roggenertrag sogar um 60% zurück. Starkregen im April und anschließende Trockenheit waren die Ursache dafür. 1852 entstand Rodolf Virchows Bericht „Die Noth im Spessart“. (22) Diese Not war u. a. darauf zurückzuführen, daß die kalte und nasse Witterung im Jahr 1851 die Kartoffelernte fast völlig ausfallen ließ. Schlechte Getreideernten hatten bereits 1846 und 1847 eine große Teuerung gebracht und wirkten sich auch auf den Spessart aus.
Das waren also die Bedingungen, die mit der Kleinen Eiszeit einhergingen. Die Kleine Eiszeit – sie hatte etwa um 1700 ihren Höhepunkt – fällt aber genau mit jenem Zeitabschnitt zusammen, die die Historiker und Klimaforscher als „vorindustrielle Zeit“ bezeichnen. Diese sog. „vorindustrielle Zeit“ endete nach Auffassung eines Forscherteams um Ed Hawkins von der englischen University of Reading zwischen 1720 und 1800. (23) Die Klimaerwärmung wird aber genau seit dieser vorindustriellen Zeit festgestellt. Wenn jedoch als Ausgangspunkt für die Klimaerwärmung die vorindustrielle Zeit und damit die Kleine Eiszeit gewählt wird, ohne daß dieser Sachverhalt in der öffentlichen Debatte Erwähnung findet, dann kann das nicht seriös sein. Ganz natürlich mußte die Temperatur nach der Keinen Eiszeit wieder ansteigen. Das heißt nicht, daß es keinen menschengemachten Anteil am Klimawandel durch CO2-Ausstoß geben könnte. Aber wir wissen nicht, wie hoch dieser ist. Wissen wir aber nicht genau, wie hoch er ist, läßt sich auch kein 1,5 Grad Ziel des Temperaturanstiegs festlegen, denn das Klima läßt sich von uns nicht einstellen wie eine Maschine (mechanistisches Denken). Wir müßten über alle Faktoren und entsprechende Daten verfügen, die das Klima beeinflussen, um hier genaue Aussagen treffen zu können. Monokausal das CO2 dafür verantwortlich zu machen, hat etwas infantiles, denn monokausal denken Einfältige und Kinder. Und so ist es auch nicht zufällig, daß die Bewegung um „Fridays for Future“ aus Kindern besteht. Sie wird dazu noch von einer mittlerweile jungen Frau angeführt, die an einem Asperger-Syndrom leidet. „Gebt den Kindern das Kommando, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Der ganze Vorgang erinnert einen Historiker nicht nur an die Kinderkreuzzüge im Mittelalter, sondern auch an eine Begebenheit aus der südafrikanischen Geschichte. Es geht um ein Mädchen. Ihr Name: Nongqawuse (1841 – 1898). Sie galt als Prophetin und gehörte zum Volk der Xhosa. 1856, da war sie gerade 15 Jahre alt, behauptete sie, von drei Geistern beauftragt worden zu sein, das Volk zur Tötung des gesamten Viehs und zur Vernichtung der Ernte zu veranlassen. Die Geister der Toten würden danach wieder auferstehen (Elementargedanke?) und große gesunde Viehherden aus der Erde auftauchen. Außerdem würden große Felder mit Getreide erntereif erscheinen. Daraufhin wurden tatsächlich ca. 300.000 bis 400.000 Rinder getötet. Nach dem Scheitern der Prophezeiung starben bis zu 50.000 Menschen den Hungertod.
Der Vergleich ist durchaus nicht abwegig. Schon werden Forderungen nach einem Klima-Lockdown laut. Offensichtlich sind Teile unserer Gesellschaft geradezu besessen von der Vorstellung, die deutsche Wirtschaft ruinieren zu müssen. Die Ökonomie als Basis unseres Lebens scheint unsere intellektuellen Eliten kaum noch zu interessieren. Sie schützen die Wölfe mehr als das Nutzvieh. Hätte man das einem Bauern nach einer Zeitreise in die Welt von vor 100 Jahren berichtet, hätte er uns für völlig geistig verwirrt gehalten. Vielleicht hätte er sogar mit seinem Jagdgewehr auf uns geschossen, denn er hätte eine gefährliche, ansteckende und damit um sich greifende Geisteskrankheit in uns vermutet. Und – hätte er so unrecht damit gehabt? Natürlich ist dieses Gehabe um den Wolf ein Ausdruck von romantischer Naturschwärmerei einer übersatten Herrschaftselite, insbesondere des Bildungsbürgertums. Was denn sonst? Lebensmittel stellen keinen zentralen Wert mehr dar. Das kann kein gesunder Zustand für eine Gesellschaft sein.
Innerhalb der „Moderne“ neigt sich jedoch diese spätbürgerliche Phase ihrem Ende. Nicht eine Klimakatastrophe in Richtung immer höherer Temperaturen, sondern eine neue „Kleine Eiszeit“ steht vor der Tür. (24) Klimaforscher rechnen damit, daß etwa 2021, 2030 oder 2050 aufgrund der Verminderung der Sonnenaktivität die nächste Kälteperiode kommt. Wir müssen dann zwar wesentlich mehr heizen, sollen aber aufgrund einer angenommenen menschengemachten Klimaerwärmung wesentlich mehr für die Heizung bezahlen – von Jahr zu Jahr mehr. Eine Rentnerin oder ein Rentner, die z. B. 750 Euro Rente ausgezahlt bekommen, werden das nicht mehr stemmen können. Wohngeld löst das Problem nicht, denn wer größere Ersparnisse hat, bekommt kein Wohngeld, sondern muß von der Substanz zehren. Hier könnte ein riesiges Heer der Unzufriedenen heranwachsen – natürlich nicht nur unter den Rentnern.
Die Frage ist durchaus nicht abwegig: Wird es vielleicht nach Klimaverschlechterungen und ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen sogar zu schweren sozialen Unruhen kommen wie ab 1788 in Frankreich? Wir wissen es nicht. Die westlichen Eliten, auch die Eliten der BRD, haben sich auf den menschengemachten Klimawandel festgelegt. Sie könnten sich damit aber auch bis auf die Knochen blamieren, sollte es jetzt zu einer Kleinen Eiszeit kommen. Es gibt nämlich noch andere Erklärungsmuster für Klimaschwankungen. (25)
Erschreckend daran ist – und das hat mich wirklich bis ins Mark erschüttert –, daß das Bundesverfassungsgericht sich in die Klimadiskussion eingemischt hat. (26) Am 24. März 2021 hatten acht Richter unter dem Vorsitz von Stephan Harbarth einstimmig das Urteil zum Klimaschutzgesetz beschlossen. Danach sei der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2022 verpflichtet, die Fortschreibung der Minderungsziele der Treibhausemissionen für die Zeiträume nach 2030 näher zu regeln. Dabei beziehen sie sich auf den Artikel 20a GG und eine Gesetzgebung, die sich das Ziel gesetzt hat, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Hier kommt also wieder das vorindustrielle Niveau ins Spiel, das bekanntlich durch die „Kleine Eiszeit“ geprägt war. Da wir aber nicht wissen, wie hoch der menschengemachte Anteil am Klimawandel ist und welche Faktoren – außer CO2 – noch eine Rolle dabei spielen, können wir auch kein 1,5 Grad Ziel festlegen. Wie bereits ausgeführt: Das Klima ist keine Maschine, an der ich mal eben 1,5 Grad einstellen kann! Der Kenntnisstand der Wissenschaft ist einfach noch viel zu gering, um hier konkrete Ziele definieren zu können.
Und der wissenschaftliche Kenntnisstand ist auch noch viel zu gering, um überhaupt eine Aussage zur Wirkung von CO2 treffen zu können. Einige Klimaforscher haben das getan und werden derzeit heiß diskutiert. (27) Da ich kein Klimaexperte bin, werde ich mich an dieser Diskussion nicht beteiligen. Im Rahmen dieser Abhandlung konnte ich deshalb auch nur die Schnittstellen aufzeigen, wo es Ungereimtheiten gibt und Widersprüche, wo wir belogen werden und um die Früchte unserer harten Arbeit betrogen werden sollen. Es galt, diktatorische Ansätze, die einer „deutschen Unbedingtheit“ (Plessner) zu entspringen scheinen, zu erkennen und zu entlarven. (28) Diktatorische Ansätze, die, wie in der völlig überzogenen deutschen Corona-Politik, einen deutschen Sonderweg darstellen. (29) Dazu kommt: Es geht um Geld, um sehr viel Geld, das der Bürger für die „Klimarettung“ ausgeben soll. Zwar propagieren die Grünen im Wahlkampf eine Klimarettung mit sozialem Ausgleich – das muß man der Ehrlichkeit halber sagen – doch ist eine Durchsetzung solcher Forderungen nicht sehr glaubhaft, weil die Welteliten bereits etwas ganz anderes beschlossen haben.
Das Ziel der Klimapolitik besteht nach meiner Auffassung nämlich gar nicht in der Klimarettung, sondern in der Umverteilung des Weltvermögens. Eine gigantische Umverteilung ist geplant. Diesmal von Nord nach Süd. Das hat bereits 2010 der Chefvolkswirt des Potsdamer Instituts für Klimaforschung, Ottmar Edenhofer im Gespräch sowohl mit der NZZ als auch mit der FAZ offen zugegeben. Zur globalen Verteilung von Emissionsrechten pro Kopf der Bevölkerung meine er: „Das würde eine erhebliche Umverteilung bewirken, vor allem zugunsten von Afrika und Indien“ (30) und „dann ist Afrika der große Gewinner, und es fließt viel Geld dorthin. Das hat für die Entwicklungspolitik enorme Konsequenzen.“ (31) Ganz nebenbei gesagt, Edenhofer war nicht nur für den Weltklimarat aktiv, sondern von 1987 bis 1994 Mitglied des Jesuitenordens. Da wird einiges klar. Das ganze Netzwerk von Verflechtungen aufzuzeigen, dem Edenhofer angehört, kann in diesem Rahmen nicht geleistet werden.
Tatsächlich geht es den intellektuellen Eliten um globale Entwicklungspolitik, eine ökologisch verschleierte Entwicklungshilfe auf unsere Kosten. Hat die Entwicklungshilfe der letzten 50 Jahre, die wesentliche Anteile von Staatshaushalten afrikanischer Staaten subventionierte, schon nichts gebracht, so erhofft man sich jetzt mit der Umverteilung astronomischer Summen durch Klimaabgaben den großen Durchbruch. Daß sich die herrschenden Eliten Afrikas seit der Unabhängigkeit ihrer jeweiligen Länder als völlig unfähig erwiesen haben, hat man bei uns immer noch nicht begriffen. Und was meinen diese „Klimaretter“ eigentlich, woher die Summen für die „erhebliche Umverteilung“ kommen? Wo gewaltige Summen abfließen, muß jemand einen erheblichen Verlust erleiden! Wem eigentlich werden diese Summen weggenommen? Es sind wieder einmal die Armen, die Rentner und der verarmte handwerkliche und kleingewerbliche Mittelstand, die dieses kapitalistische Weltexperiment bezahlen sollen, denn diese Schichten machen den größten Teil der Gesellschaft aus. Der soziale Sprengstoff, der darin verborgen liegt, ist in seiner Wirkung noch gar nicht erkannt.
Was sich hier westliche Intellektuellengehirne ausgedacht haben, Gehirne von Menschen, die sich zeitlebens ausschließlich vom Staat durch extrem hohe Gehälter haben alimentieren lassen, verschlägt einem fast die Sprache. Diese Wissenschaftler tun gerade so, als resultiere unser CO2-Verbrauch aus einem ausschweifenden Luxusleben. Sie schließen von sich auf die gesamte Bevölkerung. Und die ist eben auf fossile Heizmittel angewiesen. Da wir aber als Mittel- und Nordeuropäer im Winter nicht ohne Heizung auskommen können – schon gar nicht in einer neuen „Kleinen Eiszeit“ – würde diese Umverteilung letztendlich zu einer Verarmung von ¾ der Bevölkerung auf Harz IV Niveau führen. Und dieses Niveau müßte dann noch weiter abgesenkt werden. Die Reichen werden sich – wie immer – rauszuwinden verstehen. Ausschließlich die Armen, bzw. ein verarmter Mittelstand werden die Lasten tragen. Darauf muß die Zivilgesellschaft eine klare Antwort finden und die kann nur lauten: So nicht! Jetzt muß ein deutliches „Halt“ gesprochen werden. Der Aufbau einer breiten Volksbewegung aller demokratischen Kräften zur Abwehr von Klimahysterie, globalem Umverteilungswahn und einheimischer Massenarmut ist jetzt das Gebot der Stunde.
Quellen und Anmerkungen
- Baerbock, Annalena: „Annalena Baerbock vor Ort“. Open-Air-Veranstaltung 2019
- Popper, Karl: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. 1945
- Böttger, Christian: Die Gefahren, die durch die Verschmutzung der Atmosphäre entstehen, und ihre Bekämpfung. Jahresarbeit im Fach Biologie (12. Klasse). Berlin 1973, S. 3
- Ebenda, S. 4
- Jahn, Peter Milan: Vom Roboter zum Schulpropheten. Hanso Nepila (1766 – 1856). Mikrohistorische Studien zu Leben und Werk eines wendischen Fronarbeiters und Schriftstellers aus Rohne in der Standesherrschaft Muskau. Bautzen 2010
- https://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-im-mittelalter-war-es-waermer-als-heute#:~:text=Die%20Mittelalterliche%20Warmzeit%20ist%20hier,in%20S%C3%BCdamerika%20teils%20deutlich%20k%C3%BChler.
- Böttger, Christian: Autonomie für die Afrikaanse Nation. Ein Superethnos in Südafrika. Schnellbach 2020
- Tyson, P. D. & Lindesay, J. A.: The climate of the last 2000 years in southern Africa. In: The Holocene 2, 1992; Tyson, P. D., Karlen, W., Holmgren, K. & Heiss, G.: The little Ice Age and medieval warming in South Africa. In: South African Journal of Science 96. 2000; Tyson, P. D., Lee-Thorp, J., Holmgren, K. & Thackeray, J. F.: Changing gradients of climate change in southern Africa during the past millennium: implications for population movements. In: Climate Change 52, 2002
- Huffman, Thomas N.: Pre-colonial history of Southern Africa. In: South African History online (SAHO) 2010: http://www.sahistory.org.za/article/pre-colonial-history-southern-africa
- Matsche, Thomas: Wissenschaftsleugnung und wie man ihr begegnen kann. 5 Methoden, die Laien beim Entlarven von Desinformationen helfen sollen. Sendung vom 04. 06. 2021, 8.53 Uhr; Nach klimafakten.de sollen z. B. Pseudoexperten daran zu erkennen sein, daß sie nicht zitiert oder diskutiert werden. Sie sollen zukünftig mit einem „P“ gekennzeichnet werden. Das ist eine Argumentation, die einfach nur lächerlich ist und an die schlimmsten Phasen der Geschichte erinnert, weil sie Andersdenkende in abwertend gemeinte Kategorien einteilt, um sie aus der Diskussion herauszuhalten. Deutlich sind hierin Anhaltspunkte einer in Entstehung begriffenen Diktatur zu erkennen.
- https://www.science-e-publishing.de/project/lv-twk/002-holozaene-optima-und-pessima.htm
- Lexikon früher Kulturen, Band 2, Leipzig 1984, S. 368
- Die Germanen. Ein Handbuch, Berlin 1983, Band 1, S. 75
- Jahn, Peter Milan: a. a. O., S. 142 f.
- Ebenda, S. 148
- Ebenda, S. 152
- Ebenda, S. 162
- Ebenda, S. 164 f.
- Ebenda, S. 167 f.
- Ebenda, S. 171
- Ullsteins Weltgeschichte, hrsg. von Prof. Dr. Julius v. Pflugk-Harttung, Bd. Neuzeit 1650 – 1815, Berlin 1905, S. 427
- Virchow, Rudolf: Die Noth im Spessart. Eine medicinisch-geographische und historische Skizze. In: Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiet der öffentlichen Medicin und Seuchenlehre, Bd. 1, Berlin 1879
- Titz, Sven: Was bedeutet eigentlich „vorindustriell“? In: NZZ-online v. 03. 02. 2017
- Odenwald, Michael: Trotz Klima-Erwärmung: Forscher sagen Mini-Eiszeit wie im Mittelalter voraus. In: Fokus Online v. 18. 01. 2019
- Miersch, Michael: Ein Physiker erschüttert die Klimatheorie. Welt online vom 14. 12. 2009; siehe auch: Schlesinger, Xaver Philipp: Zwei Studien und Henrik Svensmark contra den menschengemachten Klimawandel. In: der Freitag digital (Blog aus der Community) vom 07. 08. 2019
- Schon die Einmischung in die Definition des Volksbegriffs hätte zu einem Aufschrei in der ethnologischen Wissenschaft führen müssen. Das Grundgesetz kennt nämlich durchaus einen ethnischen Volksbegriff, nämlich in Artikel 116 mit dem Begriff der deutschen Volkszugehörigkeit. Der Artikel 116 wurde u. a. geschaffen, um nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen, die nie die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen, aber ethnische Deutsche sind, in die Bundesrepublik zu integrieren. Vor 1989 waren das z. B. die Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben und nach 1989 verstärkt die Rußlanddeutschen. Es kann nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes sein, den Volksbegriff neu zu definieren oder seinen Gebrauch zu reglementieren. Die Wissenschaftsfreiheit muß unantastbar bleiben!
- Uhlig, Stephan: Der natürliche Klimawandel. Fakten aus geologischer, archäologischer und astrophysikalischer Sicht. Weltbuch-Verlag 2021
- Plessner, Helmuth: Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus. (Erstausgabe 1924) Frankfurt am Main 2018
- Auch in der Corona-Politik scheint diese „deutsche Unbedingtheit“ zum Ausdruck zu kommen, vergleicht man die bundesdeutschen Maßnahmen mit denen in Österreich. Wer regelmäßig die österreichische Nachrichtensendung ZiB2 auf 3sat verfolgt, dem wird der Unterschied bewußt: Waren die Geschäfte in Österreich bis zum 24. Dezember geöffnet, um den Geschäftsleuten das Weihnachtsgeschäft noch zu ermöglichen, wurde die BRD 9 Tage vor Weihachten in den harten Lockdown geschickt und damit ein schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet. Besonders die Textilgeschäfte waren betroffen und mußen ihre Waren der Vernichtung zuführen. Angela Merkel könnte mit ihrer Politik als ein menschliches Sinnbild dieser „deutschen Unbedingtheit“ in die Geschichte eingehen (Merkel und Kurz als Sinnbilder einer Neuauflage des deutschen Dualismus? Diesmal ginge es dann nicht um Vorherrschaft in Deutschland, sondern um Vorbildlichkeit, den besseren Weg in und für Europa). Ihr protestantischer Familienhintergrund liefert die Grundlage dafür. Plessner würde in diesem Zusammenhang auf das Luthertum verweisen, das für die Deutschen im Norden prägend war: „Protestantismus ist die Religion der Konzessionslosigkeit, weil jeder Mensch unmittelbar zu Gott ist, und damit ein Bruch mit der Wirklichkeit.“ Ebenda, a. a. O., S. 20
- Im Gespräch: Ottmar Edenhofer: In: FAZ-Net v. 30. 11. 2010
- NZZ am Sonntag v. 14. 11. 2010

Dr. Christian Böttger
Christian Böttger, geb. 1954, Facharbeiterausbildung als Gärtner für Zierpflanzenbau mit Abitur 1974, studierte von 1983-1988 Ethnographie, deutsche Geschichte und Volkskunde an der Humboldt-Universität zu Berlin. Danach arbeitete er bis Ende 1991 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Wissenschaftsbereich Kulturgeschichte/Volkskunde am Zentralinstitut für Geschichte (Akademie der Wissenschaften der DDR) an einem Forschungsprojekt auf dem Gebiet der Kulturgeschichte sozialer Reformbewegungen in Deutschland um 1900. Ende 1993 promovierte er an der Humboldt-Universität zum doctor philosophiae. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Lexikonprojekten beschäftigt.
Autor der Bücher:

Christian Böttger: Ethnos. Der Nebel um den Volksbegriff.
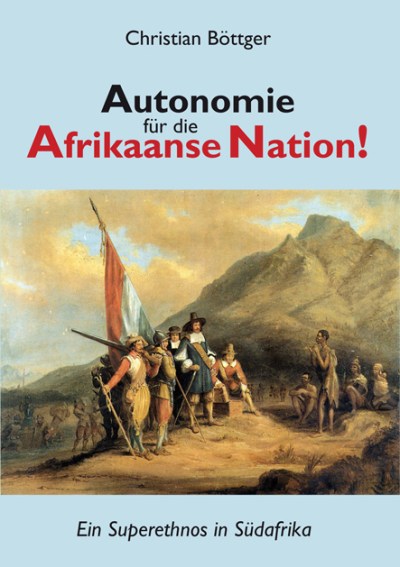
NEU:
Christian Böttger: Autonomie für die Afrikaanse Nation! Ein Superethnos in Südafrika